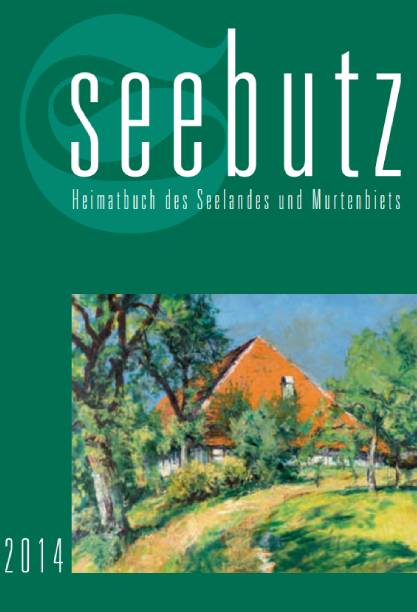Historisches Archiv der Region Biel, Seeland und Berner Jura
Fünfter Spaziergang
Juragewässer - Region / Agglomeration Biel - Boote und Segelschiffe - Ein- und Auswanderung - Freizeit - Fussgänger und Fussgängerinnen - Gewässer - Landschaften - Musik - Naturerlebnis - Panorama - Pflanzen - Rebbau und Weinlese - Tiere - Ufer
Schon mehrfach habe ich an bezaubernden Orten gewohnt, aber keinem verdanke ich so wahrhaft glückliche Stunden und keinem trauere ich so innig nach wie der Petersinsel im Bieler See. Selbst in der Schweiz kennen sie nur wenige; die Neuenburger nennen die kleine Insel "Île de la Motte". Meines Wissens erwähnt sie kein Reisebericht. Dabei ist sie sehr anmutig und von der Lage her wie geschaffen für jemanden, der sich lieber abseits hält. Vielleicht bin ich ja der Einzige auf der Welt, der isoliert leben muss, weil ihn das Schicksal dazu verurteilt hat - aber sollte ich etwa ebenso der Einzige sein, der dies auch aus freien Stücken täte? Ich kann nicht glauben, dass nur ich diesen doch ganz natürlichen Wunsch hege; bisher habe ich allerdings noch keinen zweiten getroffen.
Die Ufer des Bieler Sees wirken urwüchsiger und romantischer als die des Genfer Sees, denn Felsen und Wälder reichen näher ans Wasser; aber sie sind nicht minder einladend. Wenn es hier weniger Äcker und Weinberge gibt, weniger Städte und Häuser, so gibt es mehr natürliches Grün, mehr Wiesen, mehr schattige Haine, ie Zuflucht gewähren; die Landschaft wechselt rascher, und die Höhenunterschiede liegen näher beieinander. Da an jenen glücklichen Gestaden fuhrwerktaugliche Strassen fehlen, kommen wenig Reisende in die Gegend. Das macht sie umso attraktiver für den einsamen Denker, der sich nach Herzenslust an den Reizen der Natur ergötzen und sich in ihrer Stille sammeln will. Hier findet er eine Ruhe, die kaum ein Geräusch durchbricht; er hört vielleicht dann und wann einmal einen Adler schreien, Singvögel zwitschern oder die Wildbäche tosen, die von den Bergen herabstürzen. Das schöne, fast kreisrunde Becken hat in seiner Mitte zwei kleine Inseln. Auf der einen, deren Umfang etwa eine halbe Meile beträgt, wohnen Leute und bestellen den Boden; die andere, kleinere, ist unbewohnt und liegt brach. Sie wird irgendwann nicht mehr da sein, weil man ständig beträchtliche Ladungen Erde von ihr wegfährt, um die Schäden zu beheben, die Wind und Wellen an der grossen Insel verursachen. So wird die Substanz des Schwachen immer zum Nutzen des Starken verwandt.
Auf der Insel gibt es nur ein einziges Haus; dieses allerdings ist gross, recht hübsch und gemütlich und gehört, wie die ganze Insel, dem Berner Spital. Es wohnt darin ein Steuereinnehmer samt Familie und Gesinde, der dort auch einen Geflügelhof mit vielen Hühnern, einen Taubenschlag und mehrere Fischteiche unterhält. So klein die Insel ist, so zeigt sie sich dem Blick doch recht vielgestaltig, und sie bietet Böden und Lagen in solcher Mannigfaltigkeit, dass praktisch alles angebaut werden kann. Man findet Äcker, Rebflächen, Gehölze, Obstgärten, fette Weiden, von Wäldchen beschattet und von allerlei Büschen und Sträuchern eingefasst, die das nahe Seewasser frisch erhält. Ein stattlicher Höhenzug, bepflanzt mit Bäumen in Zweierreihen, durchzieht den Inselrand der Länge nach; in seiner Mitte hat man einen hübschen Aussichtspavillon errichtet, bei dem sich die Bewohner der Ufer ringsum während der Weinlese sonntags zum Tanze versammeln.
Auf diese Insel bin ich nach der Steinigung von Môtiers geflohen. Ich fand den Ort so reizend, und das Leben, das ich dort führte, entsprach so sehr meinem Geschmack, dass ich mich entschloss, den Rest meiner Tage daselbst zu verbringen. Nur musste ich befürchten, dass man mir dies nicht erlauben würde, denn es vertrug sich schlecht mit dem Plan gewisser Leute, mich nach England zu verfrachten - die ersten Versuche, ihn umzusetzen, konnte ich schon verzeichnen, und sie erweckten in mir böse Ahnungen. Ich hätte damals vorgezogen, man würde mir dieses Refugium zum Gefängnis auf Lebenszeit bestimmen, mich für immer dorthin verbannen, mir jede Möglichkeit, die Insel wieder zu verlassen, und auch jede Hoffnung, je wieder fort zu dürfen, nehmen und mir jeden Kontakt mit dem Festland untersagen. Was in der Welt geschah, wäre nicht mehr zu meiner Kenntnis gelangt, und nach einer Weile hätte ich sie ebenso vergessen wie sie mich.
Man vergönnte mir kaum zwei Monate auf dieser Insel: ich aber hätte zwei Jahre, zwei Jahrhunderte, ja die ganze Ewigkeit dort verbracht, ohne mich einen Augenblick zu langweilen. Dabei hatte ich als Gesellschaft, neben meiner Gefährtin, doch lediglich den Steuereinnehmer, seine Frau und sein Gesinde: brave Leute, weiter nichts, aber genau, was mir nottat. Ich halte diese zwei Monate für meine glücklichste Zeit - so glücklich, dass es für mein ganzes Erdendasein gereicht hätte, ohne dass in mir je der Wunsch aufgekommen wäre, anders zu leben.
Welcher Art war nun dieses Glück, und welche Genüsse bot es? Dies dürften die Menschen meines Jahrhunderts kaum erraten, und wenn ich ihnen noch so genau beschriebe, wie ich dort lebte. Die erste und wichtigste dieser Freuden war das unschätzbare far niente, das ich in seiner ganzen Süsse auskosten wollte. Und wirklich gab ich mich während meiner Zeit auf der Insel einzig jener wonnevollen Beschäftigung hin, der nun einmal nachgehen muss, wer sich dem Nichtstun verschrieben hat.
Eine Weile hegte ich die Hoffnung, dass jene, die mich weghaben wollten, eigentlich begrüssen müssten, wenn ich an diesem einsamen Ort bliebe, an den ich mich selber gekettet hatte: ich konnte ihn nicht ohne fremde Hilfe und nicht unbemerkt verlassen und weder Briefverkehr noch sonstige Verbindungen zur Aussenwelt pflegen, es sei denn, die Leute aus meiner nächsten Umgebung betätigten sich als Mittler. Besagte Hoffnung nährte eine zweite, nämlich jene, dass es in meinen restlichen Erdentagen nicht mehr so unruhig zugehen werde wie bis dahin. Ich glaubte, ich hätte noch jede Menge Zeit, mich in aller Ruhe einzurichten, und kümmerte mich vorderhand nicht darum. Da ich ja sehr plötzlich auf diese Insel versetzt worden war, stand ich nun allein da und hatte nichts dabei; also liess ich erst meine Haushälterin, dann meine Bücher und meine übrigen Habseligkeiten nachkommen. Es bereitete mir regelrecht Vergnügen, meine Koffer und Kisten nicht anzurühren, und so lebte ich an dem Ort, da ich meine Tage zu beschliessen gedachte, wie in einer Herberge, aus der ich tags darauf wieder ausziehen müsste. Alles lief bestens, man hätte an dem Zustand nichts verbessern können, ohne etwas zu verderben.
Zu meinen grössten Freuden gehörte, meine Bücher weiterhin fest eingepackt zu lassen und kein Schreibzeug zu haben. Wenn mich lästige Briefe zwangen, doch einmal die Feder zu ergreifen, lieh ich mir grollend das Schreibzeug des Steuereinnehmers und gab es ihm möglichst bald wieder zurück, in der eitlen Hoffnung, ihn nie wieder darum bitten zu müssen. Statt mit traurigem Papierkram und alten Scharteken füllte ich mein Zimmer mit Blumen und Heu, denn ich hatte mich gerade frisch für die Botanik begeistert – eine Neigung, die Doktor d’Ivernois in mir geweckt hatte und die rasch zur Leidenschaft geworden war. Da ich keine Arbeit mehr verrichten wollte, die mich anstrengte, brauchte ich nun eine zum Zeitvertreib, die mir Spass machte und nur so viel Mühe bereitete, wie ein Faulenzer gern auf sich nimmt. Ich beschloss, eine Flora petrinsularis zu erstellen und sämtliche Pflanzen der Insel zu beschreiben, ohne eine einzige auszulassen, und mit einem Aufwand an Detailgenauigkeit, der mich wohl für den Rest meiner Tage beschäftigen würde. Ein Deutscher hat, so hörte ich, ein ganzes Buch über die Zitronenschale verfasst; ich hätte über jedes Wiesengras eines verfasst; über jedes Waldmoos, jede Flechte auf den Felsen; ja, noch das kleinste Grashälmchen, noch das winzigste Stäubchen des Pflanzenreichs sollte ausführliche Beschreibung erfahren. Bald schon begann ich mit der Verwirklichung des schönen Plans. Jeden Morgen nach dem gemeinsamen Frühstück besuchte ich – die Lupe in der Hand und mein Exemplar der Systema naturae unterm Arm – ein vorab festgelegtes Revier der Insel, die ich zu diesem Zweck in kleine Quadrate eingeteilt hatte, die ich nun eines nach dem anderen von Jahreszeit zu Jahreszeit durchforschen wollte. Wie sonderbar entzückt und begeistert war ich nicht, wenn meine Beobachtungen mir zu neuen Einsichten in den Bau und die Organisation der Pflanzen verhalfen. Völlig unvertraut war mir etwa das Zusammenspiel der Geschlechtsteile bei der Befruchtung. Die Unterscheidung der männlichen und weiblichen Organe, von der ich bis dahin keinen Begriff hatte, faszinierte mich bereits, wenn ich sie übungshalber zunächst an den gemeinen Arten vornahm; später würde ich sie auch an selteneren versuchen. Dass die langen Staubfäden der Braunelle gegabelt sind, die der Brennnessel und des Glaskrauts hingegen elastisch gekrümmt, dass die Frucht des Springkrauts und die Kapsel des Buchsbaums ihren Samen durch Aufplatzen freisetzen: die ganzen abertausend Spielarten der Befruchtung gewahrte ich erst jetzt. Meine Entdeckerfreude war so gewaltig, dass ich herumlief und alle Leute fragte, ob sie schon einmal die Hörner der Braunelle gesehen hätten – wie einst La Fontaine jeden fragte, ob er schon einmal den Habakuk gelesen habe. Zwei, drei Stunden später kehrte ich heim und hatte einiges gesammelt: Vorrat für den Fall, dass es nachmittags regnete; so konnte ich meiner Liebhaberei wenigstens zu Hause frönen.
Den übrigen Morgen ging ich mit dem Steuereinnehmer, seiner Frau und Thérèse zu den Arbeitern aufs Feld, wo ich ihnen meist bei der Ernte half. Besuchten mich Bekannte aus Bern, sahen sie mich oft im Geäst irgendeines grossen Baumes hocken und Obst pflücken, das ich in einen Sack füllte, den ich mir um den Leib gebunden hatte und, wenn er voll war, mit einem Strick zur Erde herabliess. Dank der vielen Bewegung den Morgen über und der guten Laune, zu der diese unweigerlich führt, tat mir die Ruhe während des Essens besonders wohl. Wenn sich das Mahl aber zu sehr hinzog und das Wetter mich lockte, hielt es mich nicht lange an der Tafel.
Während die anderen noch zu Tisch sassen, stahl ich mich fort und lief allein zum See. Bei stillem Wasser sprang ich in einen Kahn und ruderte bis zur Mitte. Dort streckte ich mich im Boot aus, den Blick zum Himmel gerichtet, und liess mich von der Strömung treiben, nicht selten stundenlang, und versank dabei in tausend verworrene, aber herrliche Träumereien, die keinen eigentlichen Gegenstand hatten und mir doch hundertmal süsser waren als alles, was man gemeinhin die Freuden des Lebens nennt. Mahnte mich die sinkende Sonne zur Heimkehr, befand ich mich oft so weit abseits der Insel, dass ich mich tüchtig ins Zeug legen musste, um noch vor Einbruch der Nacht zurück zu sein. Andere Male wollte ich nicht so gern auf den See hinaus und weilte lieber an den sattgrünen Gestaden der Insel, wo klares Wasser und schattige Kühle mich oft zum Bade luden. Besonders häufig aber fuhr ich von der grossen zur kleinen Insel und stieg an Land. Ganze Nachmittage verbrachte ich dort. Entweder ich ging, soweit es die Enge zuliess, spazieren und bahnte mir einen Weg zwischen Salweiden, Faulbäumen, Knöterich und vielerlei Gesträuch; oder ich wählte einen festen Quartierplatz, nämlich einen pflanzenbewucherten Sandhügel, auf dem Gras, Thymian und Blumen wuchsen, ja sogar roter und weisser Klee, den vermutlich irgendwer vor langer Zeit dort gesät hatte. "Wäre dies", so überlegte ich eines Tages, "nicht ein idealer Lebensraum für Kaninchen? Die könnten sich hier, ohne Verfolger fürchten zu müssen und ohne Schäden zu stiften, ungestört vermehren." Kaum hatte ich dem Einnehmer meinen Gedanken mitgeteilt, liess er Kaninchen aus Neuenburg kommen, männliche und weibliche; um das weitere kümmerten sich nun seine Frau, eine ihrer Schwestern, Thérèse und ich: in geradezu feierlichem Rahmen begaben wir uns auf die kleine Insel und setzten die Tiere aus. Zum Zeitpunkt meiner Abreise hatten sie sich dann schon deutlich vervielfacht, und falls sie die harten Winter überstanden haben, gedeihen sie wohl noch heute prächtig. Die Gründung der kleinen Kolonie war für uns ein Fest. Der Steuermann der Argonauten dürfte nicht stolzer gewesen sein, als ich es war, da ich die Gesellschaft und die Kaninchen im Triumphzug von der grossen zur kleinen Insel brachte. Ferner schmeichelte mir, dass die Gattin des Einnehmers, die sonst das Wasser ausserordentlich scheute und der im Boot immer schlecht wurde, unter meiner Führung unbesorgt an Land ging und während der Überfahrt keinerlei Angst zeigte.
War der See zu unruhig für Kahnpartien, blieb ich nachmittags dennoch nicht untätig. Ich durchstreifte die Insel und botanisierte, was ich links und rechts am Wege fand. Manchmal sass ich auch in irgendeinem sehr abgelegenen, aber sehr gemütlichen Winkel und gab mich meinen Träumereien hin; ein andermal wiederum erklomm ich einen Hügel oder eine Terrasse und genoss das prächtige, bezaubernde Panorama, das der See und seine Ufer boten. Auf der einen Seite krönten nahe Berge die Gestade, auf der anderen liefen sie in reiche, fruchtbare Ebenen aus, bei denen erst ganz weit hinten bläuliche Berge den schweifenden Blick begrenzten.
Wenn der Abend nahte und mich zwang, die Höhen der Insel zu verlassen, sass ich gern an irgendeinem lauschigen Plätzchen im Sand des Seeufers. Das Rauschen der Wellen und die Bewegung des Wassers waren Vorgänge, die meine Sinne bannten; sie verdrängten aus mir jede andere Bewegung und versenkten meine Seele in eine wonnige Träumerei. Oft bemerkte ich gar nicht, wie darüber die Nacht hereinbrach. An die Stelle der inneren Regungen, die meine Träumerei vertrieben hatte, trat, was ich hier wahrnahm: das Kommen und Gehen der Fluten, ihr Rauschen, das nie abbrach, freilich bald stärker, bald schwächer wurde: nur ein Wasserspiel, aber es genügte, um mir wieder Freude am Dasein zu geben, und ich musste dabei nicht einmal denken. Dann und wann war ich versucht, in der Oberfläche des Wassers ein Sinnbild für die Unbeständigkeit der Dinge dieser Welt zu sehen, doch schwanden jene kurzen, flüchtigen Eindrücke bald in der Gleichmässigkeit der Bewegung, die mich fortdauernd wiegte und festzuhalten schien, denn ganz unwillkürlich blieb ich dort und konnte mich, wenn die Stunde der Rückkehr kam und das vereinbarte Signal ertönte, nur mit grosser Mühe losreissen.
War der Abend schön, gingen wir nach dem Essen alle noch eine Runde auf der Terrasse spazieren und atmeten die frische Seeluft ein. Wir ruhten uns in der Laube aus, lachten, plauderten, sangen gelegentlich auch ein altes Lied - dem Herumgeträllere, das jetzt Mode ist, stand es bestimmt nicht nach. Dann ging jeder schlafen, zufrieden mit seinem Tag und sich nur wünschend, der morgige möge werden wie der heutige.
So in etwa brachte ich, wenn man von ein paar unerwarteten und lästigen Besuchen absieht, meine ganze Zeit auf der Insel zu. Nun sage mir einer, was an diesen Verhältnissen in solchem Masse erstrebenswert war, dass ich ihnen bis heute derart heftig, innig und beständig hinterhertrauere, denn immer noch, nach mittlerweile fünfzehn Jahren, kann ich des geliebten Ortes nicht gedenken, ohne dass mein drängendes Verlangen mich in meiner Phantasie wieder dorthin zurückversetzt.
Im Auf und Ab eines langen Lebens habe ich beobachtet, dass die Zeiten, derer ich mich besonders gern und mit besonderer Rührung erinnere, nicht etwa jene sind, die von süssesten Wonnen und ungestümsten Freuden gekennzeichnet waren. Diese kurzen Momente des Taumels und der Leidenschaft mögen wohl heftig sein, aber eben ihrer Heftigkeit wegen bleiben sie nur vereinzelte, scharf abgetrennte Punkte auf der Lebenskurve. Sie kommen so selten und und gehen so rasch wieder vorbei, dass sie keinen Bestand haben. Das Glück, das mein Herz vermisst, ist jedenfalls keine Reihung vieler flüchtiger Augenblicke, sondern ein einziger, aber fortwährender Zustand, der an sich nichts Ungestümes hat, dem jedoch eben seine Dauerhaftigkeit einen solchen Reiz verleiht, dass man letztlich die höchste Seligkeit darin findet.
Alles auf Erden ist in stetigem Fluss. Nichts behält eine feste, bleibende Gestalt, und unsere Emotionen, die sich an die Dinge der Aussenwelt heften, ändern sich und erlöschen notwendigerweise mit ihnen. Sie hinken uns entweder hinterher oder eilen uns voraus, rufen entweder das Vergangene wach, das nicht mehr ist, oder künden eine Zukunft, die oft genug nicht sein wird; im Jetzt aber findet das Herz nirgendwo einen Halt. Daher sind uns hienieden nur vergängliche Freuden beschieden; dauerhaftes Glück jedoch hat, so glaube ich, noch nie ein Mensch kennengelernt. Selbst die ungestümsten Wonnen bescheren uns kaum einmal einen Augenblick, in dem unser Herz aufrichtig sagen könnte: Ich wollte, dieser Augenblick währte ewig, Und mit welcher Berechtigung nennen wir einen flüchtigen Zustand Glück, der uns doch nie recht befriedigt und erfüllt? Stets lässt er Wünsche übrig: entweder wir betrauern etwas, das vorbei ist, oder wir ersehnen etwas, das noch zu geschehen hätte.
Angenommen aber, unsere Seele erreichte eine solide Ruhelage, in der sie, ihr gesamtes Wesen konzentrierend, ganz zu sich käme: dann müsste sie Vergangenheit und Zukunft gar nicht bemühen; Zeit zählte für sie nicht, denn dauernd wäre Gegenwart, ohne dass sich diese Dauer freilich bemerkbar machte, ohne dass irgendwo sich ein Vorher und ein Nachher abzeichnete, und ohne dass Gefühle entstünden wie Entbehrung oder Genuss, Freude oder Kummer, Verlangen oder Furcht. Wir hätten einzig das Gefühl zu existieren, dieses würde aber unsere Seele ganz erfüllen. Wer sich in solchem Zustand befindet, kann sich, solange er währt, glücklich nennen. Und es wäre dies nicht jenes unvollkommene, armselige, bedingte Glück, das die Freuden des Lebens bieten, sondern ein reichliches, makelloses, vollkommenes Glück, das in der Seele keine Lücke hinterliesse, die man noch zu schliessen begehrte. In eben dem Zustand nun war ich auf der Petersinsel oft. Meine einsamen Träumereien bescherten ihn mir, wenn ich im Boot lag und mich treiben liess, wenn ich bei schwerem Wetter am Seeufer sass, aber auch, wenn ich an einem malerischen Flüsschen oder einem Bach weilte, der über Kies dahinmurmelte.
Was eigentlich geniessen wir in solch einer Stimmung? Nur uns selbst und unser eigenes Dasein, nichts jedenfalls, das ausserhalb von uns wäre. Solange dieser Zustand währt, sind wir, wie Gott, uns selbst genug. Das blosse Gefühl zu existieren ist - vorausgesetzt, es mengen sich keine anderen Gemütsregungen hinein - an sich bereits eine kostbare Quelle der Zufriedenheit und der Seelenruhe. Schon dieses Gefühl sollte uns genügen, dass wir unser Dasein als wert- und reizvoll empfinden. Freilich darf, wer dies will, sich nicht den vielen irdisch-sinnlichen Eindrücken ausliefern, die uns hienieden immerfort zerstreuen und ablenken: sie nämlich trüben den Reiz. Die meisten Menschen kennen, weil ihre Leidenschaften sie pausenlos umtreiben, diesen Zustand nicht, und da sie ihn nur für Augenblicke und unvollkommen gekostet haben, bewahren sie von ihm nur eine dunkle und wirre Vorstellung, die ihnen nicht erlaubt, seinen ganzen Zauber zu erleben. Bei der gegenwärtigen Lage der Dinge wäre es auch gar nicht gut, wenn sie plötzlich Lust auf jene süssen Ekstasen bekämen, denn das würde ihnen nur die rastlose Betriebsamkeit verleiden, zu der ihre stetig wachsenden Bedürfnisse sie zwingen. Jedoch kann ein Unglücklicher, der aus der Gesellschaft verstossen wurde und dem auf Erden nicht mehr gegeben ist, anderen oder sich selbst Gutes und Nützliches zu tun, in diesem Zustand einen Ersatz für alle menschlichen Freuden finden, den ihm weder das Schicksal noch die Menschen wieder zu nehmen vermögen.
Freilich steht der Ersatz nicht jedermann und in jeder Situation zu Gebote. Das Herz muss ganz ruhig sein, und keine Leidenschaft darf seinen Frieden stören. Ein solches Gefühl kann nur empfinden, wer in der geeigneten Verfassung ist, und auch die Dinge ringsum spielen eine Rolle. Es sollte dort weder völlige Reglosigkeit noch zu viel Unruhe herrschen; zu wünschen wäre eine sanfte und gleichförmige, ruckfreie und nicht unterbrochene Bewegung. Wenn sich gar nichts mehr bewegt, bleibt das Leben ein stumpfes Dämmern. Ist die Bewegung unregelmässig oder zu heftig, weckt sie uns, bringt uns zurück zu den Dingen ringsum, zerstört den Zauber der Träumerei, indem sie uns der Innenwelt entreisst: flugs sehen wir uns wieder unter das Joch des Schicksals gepresst und spüren wieder so recht unser Elend. Absolute Stille indes macht traurig. Sie bietet ein Bild des Todes. In solcher Lage braucht man den Beistand einer heiteren Phantasie, und wen der Himmel damit begabt hat, erhält ihn auch, ohne sich gross zu mühen. Die Bewegung, die nicht von aussen kommt, entsteht dann in unserem Inneren. Die Ruhe ist zwar geringer, aber angenehmer, wenn leichte, liebliche Gedanken sich einstellen, welche nicht etwa den Grund der Seele aufrühren, sondern gewissermassen nur ihre Oberfläche streifen. Man bedarf ihrer nur so viele, dass man sich der eigenen Existenz wieder bewusst wird und seine Leiden vergisst. Diese Art Träumerei kann man überall pflegen, wo man ungestört ist. Ich habe früher sogar oft vermeint, ich könnte auch in der Bastille, ja selbst in einem Verlies, das so finster wäre, dass ich nichts zu Gesicht bekäme, angenehm träumen.
Doch ich bekenne gern, dass sich dies weit besser und angenehmer auf einer fruchtbaren Insel bewerkstelligen liess, einem einsam gelegenen, von der übrigen Welt durch eine natürliche Grenze geschiedenen Stück Land, wo sich meinem Blick nur heitere Bilder boten; wo nichts betrübende Erinnerungen in mir wachrief; wo die wenigen Bewohner mir durch ihre entgegenkommende Art zu einer Gesellschaft wurden, die mir lieb war, aber mein Interesse wiederum nicht so weit gefangennahm, dass ich mich nur noch mit ihr befasst hätte; wo ich endlich den ganzen Tag ungehindert und unbesorgt meinen Neigungen frönen oder mich dem lässigsten Müssiggang hingeben konnte. Ganz ohne Zweifel eine günstige Gelegenheit für einen geübten Träumer, der es verstand, sich inmitten unerfreulichster Dinge von Hirngespinsten zu nähren: hier konnte er nun seine Seele nach Herzenslust mit all dem füttern, was seine Sinne tatsächlich wahrnahmen. Wenn ich aus einer langen, süssen Träumerei erwachte, um mich herum üppiges Grün, Blumen und Vögel sah und meinen Blick über die wildromantischen Ufer schweifen liess, die hinten am Horizont eine weite Fläche kristallklaren Wassers säumten, verwob ich all diese reizenden Dinge mit den Erdichtungen meiner Phantasie. Wenn ich dann nach und nach wieder zu mir kam und auch meiner Umgebung wieder bewusst wurde, konnte ich nicht bestimmen, wo genau die Scheidelinie zwischen Fiktion und Wirklichkeit verlief.: dass mir das einsame, besinnliche Leben an diesem schönen Ort so lieb und teuer war, hatte mit beidem gleichermassen zu tun.
Warum kann ich es nicht neu erstehen! Warum kann ich meine Tage nicht auf der geliebten Insel beschliessen! Ich würde sie ja auch nie wieder verlassen und nie wieder Bewohner des Festlandes treffen wollen. Die erinnerten mich ja doch nur an die Bedrängnisse aller Art, mit denen mich die Leute seit so vielen Jahren zu ihrem Vergnügen überhäufen. Auf der Insel vergässe ich sie bald und für immer. Sie ihrerseits vergässen mich zwar kaum ebenso rasch, aber das müsste mich nicht kümmern: wichtig wäre allein, dass sie keine Möglichkeit hätten, zu mir vorzudringen und meinen Frieden zu stören. Aller weltlichen Leidenschaften ledig, die der Trubel des gesellschaftlichen Lebens erzeugt, schwänge sich meine Seele schon einmal über den Dunstkreis des Irdischen hinaus und pflegte ersten Umgang mit den himmlischen Geistern, deren Zahl sie binnen kurzem zu vermehren hofft.
Die Menschen, das weiss ich wohl, werden sich hüten, mir eine so liebliche Freistatt wiederzugeben, die sie mir nicht gegönnt hatten. Wenigstens aber werden sie nicht verhindern können, dass ich mich jedenTag auf den Flügeln meiner Phantasie dorthin versetze und für ein paar Stunden das gleiche Vergnügen koste, das ich verspürte, wenn ich noch immer dort wohnte. Meine Lieblingsbeschäftigung dort aber wäre, nach Herzenslust zu träumen. Indem ich nun träume, ich wäre dort - erziele ich damit nicht letztlich den gleichen Effekt? Ich erziele sogar einen stärkeren, denn unter normalen Umständen bliebe die Träumerei abstrakt und eintönig - jetzt aber kann ich ihr noch bezaubernde Bilder hinzufügen und so richtiges Leben verleihen. In meinen Ekstasen erfassten meine Sinne die Gegenstände meiner Visionen oft nur unscharf - jetzt aber malt meine Träumerei sie mir um so lebensechter, je tiefer ich darin versinke.
Inzwischen empfinde ich meine erdachte Anwesenheit mitten unter ihnen oft schon intensiver und sogar lustvoller als seinerzeit die wirkliche. Mein Unglück ist jedoch, dass meine Phantasie zusehends erlahmt und die Visionen daher nur noch schleppend kommen und von kurzer Dauer sind. Ach, gerade, wenn man beginnt, seine sterbliche Hülle abzustreifen, behindert sie einen am meisten!
Copyright: Philipp Reclam jun. GmbH¬Co. KG Stuttgart
Autor: Jean-Jacques Rousseau / Quelle: 1776
Die Ufer des Bieler Sees wirken urwüchsiger und romantischer als die des Genfer Sees, denn Felsen und Wälder reichen näher ans Wasser; aber sie sind nicht minder einladend. Wenn es hier weniger Äcker und Weinberge gibt, weniger Städte und Häuser, so gibt es mehr natürliches Grün, mehr Wiesen, mehr schattige Haine, ie Zuflucht gewähren; die Landschaft wechselt rascher, und die Höhenunterschiede liegen näher beieinander. Da an jenen glücklichen Gestaden fuhrwerktaugliche Strassen fehlen, kommen wenig Reisende in die Gegend. Das macht sie umso attraktiver für den einsamen Denker, der sich nach Herzenslust an den Reizen der Natur ergötzen und sich in ihrer Stille sammeln will. Hier findet er eine Ruhe, die kaum ein Geräusch durchbricht; er hört vielleicht dann und wann einmal einen Adler schreien, Singvögel zwitschern oder die Wildbäche tosen, die von den Bergen herabstürzen. Das schöne, fast kreisrunde Becken hat in seiner Mitte zwei kleine Inseln. Auf der einen, deren Umfang etwa eine halbe Meile beträgt, wohnen Leute und bestellen den Boden; die andere, kleinere, ist unbewohnt und liegt brach. Sie wird irgendwann nicht mehr da sein, weil man ständig beträchtliche Ladungen Erde von ihr wegfährt, um die Schäden zu beheben, die Wind und Wellen an der grossen Insel verursachen. So wird die Substanz des Schwachen immer zum Nutzen des Starken verwandt.
Auf der Insel gibt es nur ein einziges Haus; dieses allerdings ist gross, recht hübsch und gemütlich und gehört, wie die ganze Insel, dem Berner Spital. Es wohnt darin ein Steuereinnehmer samt Familie und Gesinde, der dort auch einen Geflügelhof mit vielen Hühnern, einen Taubenschlag und mehrere Fischteiche unterhält. So klein die Insel ist, so zeigt sie sich dem Blick doch recht vielgestaltig, und sie bietet Böden und Lagen in solcher Mannigfaltigkeit, dass praktisch alles angebaut werden kann. Man findet Äcker, Rebflächen, Gehölze, Obstgärten, fette Weiden, von Wäldchen beschattet und von allerlei Büschen und Sträuchern eingefasst, die das nahe Seewasser frisch erhält. Ein stattlicher Höhenzug, bepflanzt mit Bäumen in Zweierreihen, durchzieht den Inselrand der Länge nach; in seiner Mitte hat man einen hübschen Aussichtspavillon errichtet, bei dem sich die Bewohner der Ufer ringsum während der Weinlese sonntags zum Tanze versammeln.
Auf diese Insel bin ich nach der Steinigung von Môtiers geflohen. Ich fand den Ort so reizend, und das Leben, das ich dort führte, entsprach so sehr meinem Geschmack, dass ich mich entschloss, den Rest meiner Tage daselbst zu verbringen. Nur musste ich befürchten, dass man mir dies nicht erlauben würde, denn es vertrug sich schlecht mit dem Plan gewisser Leute, mich nach England zu verfrachten - die ersten Versuche, ihn umzusetzen, konnte ich schon verzeichnen, und sie erweckten in mir böse Ahnungen. Ich hätte damals vorgezogen, man würde mir dieses Refugium zum Gefängnis auf Lebenszeit bestimmen, mich für immer dorthin verbannen, mir jede Möglichkeit, die Insel wieder zu verlassen, und auch jede Hoffnung, je wieder fort zu dürfen, nehmen und mir jeden Kontakt mit dem Festland untersagen. Was in der Welt geschah, wäre nicht mehr zu meiner Kenntnis gelangt, und nach einer Weile hätte ich sie ebenso vergessen wie sie mich.
Man vergönnte mir kaum zwei Monate auf dieser Insel: ich aber hätte zwei Jahre, zwei Jahrhunderte, ja die ganze Ewigkeit dort verbracht, ohne mich einen Augenblick zu langweilen. Dabei hatte ich als Gesellschaft, neben meiner Gefährtin, doch lediglich den Steuereinnehmer, seine Frau und sein Gesinde: brave Leute, weiter nichts, aber genau, was mir nottat. Ich halte diese zwei Monate für meine glücklichste Zeit - so glücklich, dass es für mein ganzes Erdendasein gereicht hätte, ohne dass in mir je der Wunsch aufgekommen wäre, anders zu leben.
Welcher Art war nun dieses Glück, und welche Genüsse bot es? Dies dürften die Menschen meines Jahrhunderts kaum erraten, und wenn ich ihnen noch so genau beschriebe, wie ich dort lebte. Die erste und wichtigste dieser Freuden war das unschätzbare far niente, das ich in seiner ganzen Süsse auskosten wollte. Und wirklich gab ich mich während meiner Zeit auf der Insel einzig jener wonnevollen Beschäftigung hin, der nun einmal nachgehen muss, wer sich dem Nichtstun verschrieben hat.
Eine Weile hegte ich die Hoffnung, dass jene, die mich weghaben wollten, eigentlich begrüssen müssten, wenn ich an diesem einsamen Ort bliebe, an den ich mich selber gekettet hatte: ich konnte ihn nicht ohne fremde Hilfe und nicht unbemerkt verlassen und weder Briefverkehr noch sonstige Verbindungen zur Aussenwelt pflegen, es sei denn, die Leute aus meiner nächsten Umgebung betätigten sich als Mittler. Besagte Hoffnung nährte eine zweite, nämlich jene, dass es in meinen restlichen Erdentagen nicht mehr so unruhig zugehen werde wie bis dahin. Ich glaubte, ich hätte noch jede Menge Zeit, mich in aller Ruhe einzurichten, und kümmerte mich vorderhand nicht darum. Da ich ja sehr plötzlich auf diese Insel versetzt worden war, stand ich nun allein da und hatte nichts dabei; also liess ich erst meine Haushälterin, dann meine Bücher und meine übrigen Habseligkeiten nachkommen. Es bereitete mir regelrecht Vergnügen, meine Koffer und Kisten nicht anzurühren, und so lebte ich an dem Ort, da ich meine Tage zu beschliessen gedachte, wie in einer Herberge, aus der ich tags darauf wieder ausziehen müsste. Alles lief bestens, man hätte an dem Zustand nichts verbessern können, ohne etwas zu verderben.
Zu meinen grössten Freuden gehörte, meine Bücher weiterhin fest eingepackt zu lassen und kein Schreibzeug zu haben. Wenn mich lästige Briefe zwangen, doch einmal die Feder zu ergreifen, lieh ich mir grollend das Schreibzeug des Steuereinnehmers und gab es ihm möglichst bald wieder zurück, in der eitlen Hoffnung, ihn nie wieder darum bitten zu müssen. Statt mit traurigem Papierkram und alten Scharteken füllte ich mein Zimmer mit Blumen und Heu, denn ich hatte mich gerade frisch für die Botanik begeistert – eine Neigung, die Doktor d’Ivernois in mir geweckt hatte und die rasch zur Leidenschaft geworden war. Da ich keine Arbeit mehr verrichten wollte, die mich anstrengte, brauchte ich nun eine zum Zeitvertreib, die mir Spass machte und nur so viel Mühe bereitete, wie ein Faulenzer gern auf sich nimmt. Ich beschloss, eine Flora petrinsularis zu erstellen und sämtliche Pflanzen der Insel zu beschreiben, ohne eine einzige auszulassen, und mit einem Aufwand an Detailgenauigkeit, der mich wohl für den Rest meiner Tage beschäftigen würde. Ein Deutscher hat, so hörte ich, ein ganzes Buch über die Zitronenschale verfasst; ich hätte über jedes Wiesengras eines verfasst; über jedes Waldmoos, jede Flechte auf den Felsen; ja, noch das kleinste Grashälmchen, noch das winzigste Stäubchen des Pflanzenreichs sollte ausführliche Beschreibung erfahren. Bald schon begann ich mit der Verwirklichung des schönen Plans. Jeden Morgen nach dem gemeinsamen Frühstück besuchte ich – die Lupe in der Hand und mein Exemplar der Systema naturae unterm Arm – ein vorab festgelegtes Revier der Insel, die ich zu diesem Zweck in kleine Quadrate eingeteilt hatte, die ich nun eines nach dem anderen von Jahreszeit zu Jahreszeit durchforschen wollte. Wie sonderbar entzückt und begeistert war ich nicht, wenn meine Beobachtungen mir zu neuen Einsichten in den Bau und die Organisation der Pflanzen verhalfen. Völlig unvertraut war mir etwa das Zusammenspiel der Geschlechtsteile bei der Befruchtung. Die Unterscheidung der männlichen und weiblichen Organe, von der ich bis dahin keinen Begriff hatte, faszinierte mich bereits, wenn ich sie übungshalber zunächst an den gemeinen Arten vornahm; später würde ich sie auch an selteneren versuchen. Dass die langen Staubfäden der Braunelle gegabelt sind, die der Brennnessel und des Glaskrauts hingegen elastisch gekrümmt, dass die Frucht des Springkrauts und die Kapsel des Buchsbaums ihren Samen durch Aufplatzen freisetzen: die ganzen abertausend Spielarten der Befruchtung gewahrte ich erst jetzt. Meine Entdeckerfreude war so gewaltig, dass ich herumlief und alle Leute fragte, ob sie schon einmal die Hörner der Braunelle gesehen hätten – wie einst La Fontaine jeden fragte, ob er schon einmal den Habakuk gelesen habe. Zwei, drei Stunden später kehrte ich heim und hatte einiges gesammelt: Vorrat für den Fall, dass es nachmittags regnete; so konnte ich meiner Liebhaberei wenigstens zu Hause frönen.
Den übrigen Morgen ging ich mit dem Steuereinnehmer, seiner Frau und Thérèse zu den Arbeitern aufs Feld, wo ich ihnen meist bei der Ernte half. Besuchten mich Bekannte aus Bern, sahen sie mich oft im Geäst irgendeines grossen Baumes hocken und Obst pflücken, das ich in einen Sack füllte, den ich mir um den Leib gebunden hatte und, wenn er voll war, mit einem Strick zur Erde herabliess. Dank der vielen Bewegung den Morgen über und der guten Laune, zu der diese unweigerlich führt, tat mir die Ruhe während des Essens besonders wohl. Wenn sich das Mahl aber zu sehr hinzog und das Wetter mich lockte, hielt es mich nicht lange an der Tafel.
Während die anderen noch zu Tisch sassen, stahl ich mich fort und lief allein zum See. Bei stillem Wasser sprang ich in einen Kahn und ruderte bis zur Mitte. Dort streckte ich mich im Boot aus, den Blick zum Himmel gerichtet, und liess mich von der Strömung treiben, nicht selten stundenlang, und versank dabei in tausend verworrene, aber herrliche Träumereien, die keinen eigentlichen Gegenstand hatten und mir doch hundertmal süsser waren als alles, was man gemeinhin die Freuden des Lebens nennt. Mahnte mich die sinkende Sonne zur Heimkehr, befand ich mich oft so weit abseits der Insel, dass ich mich tüchtig ins Zeug legen musste, um noch vor Einbruch der Nacht zurück zu sein. Andere Male wollte ich nicht so gern auf den See hinaus und weilte lieber an den sattgrünen Gestaden der Insel, wo klares Wasser und schattige Kühle mich oft zum Bade luden. Besonders häufig aber fuhr ich von der grossen zur kleinen Insel und stieg an Land. Ganze Nachmittage verbrachte ich dort. Entweder ich ging, soweit es die Enge zuliess, spazieren und bahnte mir einen Weg zwischen Salweiden, Faulbäumen, Knöterich und vielerlei Gesträuch; oder ich wählte einen festen Quartierplatz, nämlich einen pflanzenbewucherten Sandhügel, auf dem Gras, Thymian und Blumen wuchsen, ja sogar roter und weisser Klee, den vermutlich irgendwer vor langer Zeit dort gesät hatte. "Wäre dies", so überlegte ich eines Tages, "nicht ein idealer Lebensraum für Kaninchen? Die könnten sich hier, ohne Verfolger fürchten zu müssen und ohne Schäden zu stiften, ungestört vermehren." Kaum hatte ich dem Einnehmer meinen Gedanken mitgeteilt, liess er Kaninchen aus Neuenburg kommen, männliche und weibliche; um das weitere kümmerten sich nun seine Frau, eine ihrer Schwestern, Thérèse und ich: in geradezu feierlichem Rahmen begaben wir uns auf die kleine Insel und setzten die Tiere aus. Zum Zeitpunkt meiner Abreise hatten sie sich dann schon deutlich vervielfacht, und falls sie die harten Winter überstanden haben, gedeihen sie wohl noch heute prächtig. Die Gründung der kleinen Kolonie war für uns ein Fest. Der Steuermann der Argonauten dürfte nicht stolzer gewesen sein, als ich es war, da ich die Gesellschaft und die Kaninchen im Triumphzug von der grossen zur kleinen Insel brachte. Ferner schmeichelte mir, dass die Gattin des Einnehmers, die sonst das Wasser ausserordentlich scheute und der im Boot immer schlecht wurde, unter meiner Führung unbesorgt an Land ging und während der Überfahrt keinerlei Angst zeigte.
War der See zu unruhig für Kahnpartien, blieb ich nachmittags dennoch nicht untätig. Ich durchstreifte die Insel und botanisierte, was ich links und rechts am Wege fand. Manchmal sass ich auch in irgendeinem sehr abgelegenen, aber sehr gemütlichen Winkel und gab mich meinen Träumereien hin; ein andermal wiederum erklomm ich einen Hügel oder eine Terrasse und genoss das prächtige, bezaubernde Panorama, das der See und seine Ufer boten. Auf der einen Seite krönten nahe Berge die Gestade, auf der anderen liefen sie in reiche, fruchtbare Ebenen aus, bei denen erst ganz weit hinten bläuliche Berge den schweifenden Blick begrenzten.
Wenn der Abend nahte und mich zwang, die Höhen der Insel zu verlassen, sass ich gern an irgendeinem lauschigen Plätzchen im Sand des Seeufers. Das Rauschen der Wellen und die Bewegung des Wassers waren Vorgänge, die meine Sinne bannten; sie verdrängten aus mir jede andere Bewegung und versenkten meine Seele in eine wonnige Träumerei. Oft bemerkte ich gar nicht, wie darüber die Nacht hereinbrach. An die Stelle der inneren Regungen, die meine Träumerei vertrieben hatte, trat, was ich hier wahrnahm: das Kommen und Gehen der Fluten, ihr Rauschen, das nie abbrach, freilich bald stärker, bald schwächer wurde: nur ein Wasserspiel, aber es genügte, um mir wieder Freude am Dasein zu geben, und ich musste dabei nicht einmal denken. Dann und wann war ich versucht, in der Oberfläche des Wassers ein Sinnbild für die Unbeständigkeit der Dinge dieser Welt zu sehen, doch schwanden jene kurzen, flüchtigen Eindrücke bald in der Gleichmässigkeit der Bewegung, die mich fortdauernd wiegte und festzuhalten schien, denn ganz unwillkürlich blieb ich dort und konnte mich, wenn die Stunde der Rückkehr kam und das vereinbarte Signal ertönte, nur mit grosser Mühe losreissen.
War der Abend schön, gingen wir nach dem Essen alle noch eine Runde auf der Terrasse spazieren und atmeten die frische Seeluft ein. Wir ruhten uns in der Laube aus, lachten, plauderten, sangen gelegentlich auch ein altes Lied - dem Herumgeträllere, das jetzt Mode ist, stand es bestimmt nicht nach. Dann ging jeder schlafen, zufrieden mit seinem Tag und sich nur wünschend, der morgige möge werden wie der heutige.
So in etwa brachte ich, wenn man von ein paar unerwarteten und lästigen Besuchen absieht, meine ganze Zeit auf der Insel zu. Nun sage mir einer, was an diesen Verhältnissen in solchem Masse erstrebenswert war, dass ich ihnen bis heute derart heftig, innig und beständig hinterhertrauere, denn immer noch, nach mittlerweile fünfzehn Jahren, kann ich des geliebten Ortes nicht gedenken, ohne dass mein drängendes Verlangen mich in meiner Phantasie wieder dorthin zurückversetzt.
Im Auf und Ab eines langen Lebens habe ich beobachtet, dass die Zeiten, derer ich mich besonders gern und mit besonderer Rührung erinnere, nicht etwa jene sind, die von süssesten Wonnen und ungestümsten Freuden gekennzeichnet waren. Diese kurzen Momente des Taumels und der Leidenschaft mögen wohl heftig sein, aber eben ihrer Heftigkeit wegen bleiben sie nur vereinzelte, scharf abgetrennte Punkte auf der Lebenskurve. Sie kommen so selten und und gehen so rasch wieder vorbei, dass sie keinen Bestand haben. Das Glück, das mein Herz vermisst, ist jedenfalls keine Reihung vieler flüchtiger Augenblicke, sondern ein einziger, aber fortwährender Zustand, der an sich nichts Ungestümes hat, dem jedoch eben seine Dauerhaftigkeit einen solchen Reiz verleiht, dass man letztlich die höchste Seligkeit darin findet.
Alles auf Erden ist in stetigem Fluss. Nichts behält eine feste, bleibende Gestalt, und unsere Emotionen, die sich an die Dinge der Aussenwelt heften, ändern sich und erlöschen notwendigerweise mit ihnen. Sie hinken uns entweder hinterher oder eilen uns voraus, rufen entweder das Vergangene wach, das nicht mehr ist, oder künden eine Zukunft, die oft genug nicht sein wird; im Jetzt aber findet das Herz nirgendwo einen Halt. Daher sind uns hienieden nur vergängliche Freuden beschieden; dauerhaftes Glück jedoch hat, so glaube ich, noch nie ein Mensch kennengelernt. Selbst die ungestümsten Wonnen bescheren uns kaum einmal einen Augenblick, in dem unser Herz aufrichtig sagen könnte: Ich wollte, dieser Augenblick währte ewig, Und mit welcher Berechtigung nennen wir einen flüchtigen Zustand Glück, der uns doch nie recht befriedigt und erfüllt? Stets lässt er Wünsche übrig: entweder wir betrauern etwas, das vorbei ist, oder wir ersehnen etwas, das noch zu geschehen hätte.
Angenommen aber, unsere Seele erreichte eine solide Ruhelage, in der sie, ihr gesamtes Wesen konzentrierend, ganz zu sich käme: dann müsste sie Vergangenheit und Zukunft gar nicht bemühen; Zeit zählte für sie nicht, denn dauernd wäre Gegenwart, ohne dass sich diese Dauer freilich bemerkbar machte, ohne dass irgendwo sich ein Vorher und ein Nachher abzeichnete, und ohne dass Gefühle entstünden wie Entbehrung oder Genuss, Freude oder Kummer, Verlangen oder Furcht. Wir hätten einzig das Gefühl zu existieren, dieses würde aber unsere Seele ganz erfüllen. Wer sich in solchem Zustand befindet, kann sich, solange er währt, glücklich nennen. Und es wäre dies nicht jenes unvollkommene, armselige, bedingte Glück, das die Freuden des Lebens bieten, sondern ein reichliches, makelloses, vollkommenes Glück, das in der Seele keine Lücke hinterliesse, die man noch zu schliessen begehrte. In eben dem Zustand nun war ich auf der Petersinsel oft. Meine einsamen Träumereien bescherten ihn mir, wenn ich im Boot lag und mich treiben liess, wenn ich bei schwerem Wetter am Seeufer sass, aber auch, wenn ich an einem malerischen Flüsschen oder einem Bach weilte, der über Kies dahinmurmelte.
Was eigentlich geniessen wir in solch einer Stimmung? Nur uns selbst und unser eigenes Dasein, nichts jedenfalls, das ausserhalb von uns wäre. Solange dieser Zustand währt, sind wir, wie Gott, uns selbst genug. Das blosse Gefühl zu existieren ist - vorausgesetzt, es mengen sich keine anderen Gemütsregungen hinein - an sich bereits eine kostbare Quelle der Zufriedenheit und der Seelenruhe. Schon dieses Gefühl sollte uns genügen, dass wir unser Dasein als wert- und reizvoll empfinden. Freilich darf, wer dies will, sich nicht den vielen irdisch-sinnlichen Eindrücken ausliefern, die uns hienieden immerfort zerstreuen und ablenken: sie nämlich trüben den Reiz. Die meisten Menschen kennen, weil ihre Leidenschaften sie pausenlos umtreiben, diesen Zustand nicht, und da sie ihn nur für Augenblicke und unvollkommen gekostet haben, bewahren sie von ihm nur eine dunkle und wirre Vorstellung, die ihnen nicht erlaubt, seinen ganzen Zauber zu erleben. Bei der gegenwärtigen Lage der Dinge wäre es auch gar nicht gut, wenn sie plötzlich Lust auf jene süssen Ekstasen bekämen, denn das würde ihnen nur die rastlose Betriebsamkeit verleiden, zu der ihre stetig wachsenden Bedürfnisse sie zwingen. Jedoch kann ein Unglücklicher, der aus der Gesellschaft verstossen wurde und dem auf Erden nicht mehr gegeben ist, anderen oder sich selbst Gutes und Nützliches zu tun, in diesem Zustand einen Ersatz für alle menschlichen Freuden finden, den ihm weder das Schicksal noch die Menschen wieder zu nehmen vermögen.
Freilich steht der Ersatz nicht jedermann und in jeder Situation zu Gebote. Das Herz muss ganz ruhig sein, und keine Leidenschaft darf seinen Frieden stören. Ein solches Gefühl kann nur empfinden, wer in der geeigneten Verfassung ist, und auch die Dinge ringsum spielen eine Rolle. Es sollte dort weder völlige Reglosigkeit noch zu viel Unruhe herrschen; zu wünschen wäre eine sanfte und gleichförmige, ruckfreie und nicht unterbrochene Bewegung. Wenn sich gar nichts mehr bewegt, bleibt das Leben ein stumpfes Dämmern. Ist die Bewegung unregelmässig oder zu heftig, weckt sie uns, bringt uns zurück zu den Dingen ringsum, zerstört den Zauber der Träumerei, indem sie uns der Innenwelt entreisst: flugs sehen wir uns wieder unter das Joch des Schicksals gepresst und spüren wieder so recht unser Elend. Absolute Stille indes macht traurig. Sie bietet ein Bild des Todes. In solcher Lage braucht man den Beistand einer heiteren Phantasie, und wen der Himmel damit begabt hat, erhält ihn auch, ohne sich gross zu mühen. Die Bewegung, die nicht von aussen kommt, entsteht dann in unserem Inneren. Die Ruhe ist zwar geringer, aber angenehmer, wenn leichte, liebliche Gedanken sich einstellen, welche nicht etwa den Grund der Seele aufrühren, sondern gewissermassen nur ihre Oberfläche streifen. Man bedarf ihrer nur so viele, dass man sich der eigenen Existenz wieder bewusst wird und seine Leiden vergisst. Diese Art Träumerei kann man überall pflegen, wo man ungestört ist. Ich habe früher sogar oft vermeint, ich könnte auch in der Bastille, ja selbst in einem Verlies, das so finster wäre, dass ich nichts zu Gesicht bekäme, angenehm träumen.
Doch ich bekenne gern, dass sich dies weit besser und angenehmer auf einer fruchtbaren Insel bewerkstelligen liess, einem einsam gelegenen, von der übrigen Welt durch eine natürliche Grenze geschiedenen Stück Land, wo sich meinem Blick nur heitere Bilder boten; wo nichts betrübende Erinnerungen in mir wachrief; wo die wenigen Bewohner mir durch ihre entgegenkommende Art zu einer Gesellschaft wurden, die mir lieb war, aber mein Interesse wiederum nicht so weit gefangennahm, dass ich mich nur noch mit ihr befasst hätte; wo ich endlich den ganzen Tag ungehindert und unbesorgt meinen Neigungen frönen oder mich dem lässigsten Müssiggang hingeben konnte. Ganz ohne Zweifel eine günstige Gelegenheit für einen geübten Träumer, der es verstand, sich inmitten unerfreulichster Dinge von Hirngespinsten zu nähren: hier konnte er nun seine Seele nach Herzenslust mit all dem füttern, was seine Sinne tatsächlich wahrnahmen. Wenn ich aus einer langen, süssen Träumerei erwachte, um mich herum üppiges Grün, Blumen und Vögel sah und meinen Blick über die wildromantischen Ufer schweifen liess, die hinten am Horizont eine weite Fläche kristallklaren Wassers säumten, verwob ich all diese reizenden Dinge mit den Erdichtungen meiner Phantasie. Wenn ich dann nach und nach wieder zu mir kam und auch meiner Umgebung wieder bewusst wurde, konnte ich nicht bestimmen, wo genau die Scheidelinie zwischen Fiktion und Wirklichkeit verlief.: dass mir das einsame, besinnliche Leben an diesem schönen Ort so lieb und teuer war, hatte mit beidem gleichermassen zu tun.
Warum kann ich es nicht neu erstehen! Warum kann ich meine Tage nicht auf der geliebten Insel beschliessen! Ich würde sie ja auch nie wieder verlassen und nie wieder Bewohner des Festlandes treffen wollen. Die erinnerten mich ja doch nur an die Bedrängnisse aller Art, mit denen mich die Leute seit so vielen Jahren zu ihrem Vergnügen überhäufen. Auf der Insel vergässe ich sie bald und für immer. Sie ihrerseits vergässen mich zwar kaum ebenso rasch, aber das müsste mich nicht kümmern: wichtig wäre allein, dass sie keine Möglichkeit hätten, zu mir vorzudringen und meinen Frieden zu stören. Aller weltlichen Leidenschaften ledig, die der Trubel des gesellschaftlichen Lebens erzeugt, schwänge sich meine Seele schon einmal über den Dunstkreis des Irdischen hinaus und pflegte ersten Umgang mit den himmlischen Geistern, deren Zahl sie binnen kurzem zu vermehren hofft.
Die Menschen, das weiss ich wohl, werden sich hüten, mir eine so liebliche Freistatt wiederzugeben, die sie mir nicht gegönnt hatten. Wenigstens aber werden sie nicht verhindern können, dass ich mich jedenTag auf den Flügeln meiner Phantasie dorthin versetze und für ein paar Stunden das gleiche Vergnügen koste, das ich verspürte, wenn ich noch immer dort wohnte. Meine Lieblingsbeschäftigung dort aber wäre, nach Herzenslust zu träumen. Indem ich nun träume, ich wäre dort - erziele ich damit nicht letztlich den gleichen Effekt? Ich erziele sogar einen stärkeren, denn unter normalen Umständen bliebe die Träumerei abstrakt und eintönig - jetzt aber kann ich ihr noch bezaubernde Bilder hinzufügen und so richtiges Leben verleihen. In meinen Ekstasen erfassten meine Sinne die Gegenstände meiner Visionen oft nur unscharf - jetzt aber malt meine Träumerei sie mir um so lebensechter, je tiefer ich darin versinke.
Inzwischen empfinde ich meine erdachte Anwesenheit mitten unter ihnen oft schon intensiver und sogar lustvoller als seinerzeit die wirkliche. Mein Unglück ist jedoch, dass meine Phantasie zusehends erlahmt und die Visionen daher nur noch schleppend kommen und von kurzer Dauer sind. Ach, gerade, wenn man beginnt, seine sterbliche Hülle abzustreifen, behindert sie einen am meisten!
Copyright: Philipp Reclam jun. GmbH¬Co. KG Stuttgart
Autor: Jean-Jacques Rousseau / Quelle: 1776